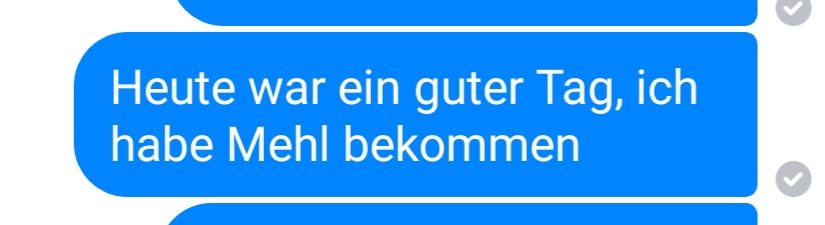Es ist sehr selten, dass ich den Drang verspüre, Pfannkuchen backen zu wollen. Wie es der Zufall so will, war es nun wieder so weit – und ich machte mich auf den Weg, um ein von mir sonst nie beachtetes Produkt zu kaufen: Mehl. Im Regal klaffte ausgerechnet dort, wo das weiße Gold sonst zu haben war, ein Loch.
So war es auch beim nächsten Einkauf ein paar Tage später. Ich hatte mich schon von dem Gedanken auf die leckeren Pfannkuchen verabschiedet, doch beim dritten Anlauf war es dann so weit: Ich stand vor dem Regal und hatte sogar die Auswahl zwischen mehreren Sorgen. Spontan stieß ich einen kleinen Freudenschrei aus! Umstehende Kunden müssen mich für verrückt gehalten haben. Es war mir egal, meine Freude war ehrlich.
Etwas später dann schrieb ich in einem Chat: „Heute war ein guter Tag, ich habe Mehl bekommen.“
Nur wenige Augenblicke, nachdem ich die Zeilen versendet hatte, musste ich laut lachen.
Denn natürlich ist das für mich nicht viel mehr als eine Episode. Zweifelsohne bin ich auch nach ein paar Wochen Corona-Krise noch immer in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe eine Festanstellung, meinen Angehörigen geht es gut. Auch wenn ich dieses und jenes zur Zeit nicht wie gewohnt sofort bekommen kann, so lebe ich doch nach wie vor im Überfluss. Ich bin mir dessen bewusst, ich bin dafür dankbar.
Die Freude über das Mehl erinnert mich an die vielen Momente des kleinen Glücks bei meinen Radreisen, etwa wenn ich nach langer Fahrt durch die Hitze an einen schattenspendenden Ort gelangt bin. Wo ich ein bisschen Abkühlung gefunden habe. Wo ich meine Flaschen, in denen sich nur noch Reste schwülwarmer, abgestandener Flüssigkeit befanden, mit dem wohl wertvollsten Schatz auffüllen konnte, den man sich vorstellen kann: mit Kostbarem, kühlem, klarem, erfrischendem Wasser.
Meine Augen strahlen noch heute, wenn ich daran zurückdenke, wie ich an einem Brunnen auf dem Dorfplatz meinen Kocher aufgestellt habe und zwiebelschneidend mit der italienischen Nonna ins Gespräch gekommen bin, die mir eine saftige Tomate schenkte und mein bescheidendes Abendessen damit ungemein aufwertete.
Wie mich indische Schwarzarbeiter im Süden des Kontinents eingeladen haben, ihr Gast in ihren Containern zu sein.
Wie mich die serbischen Roma in einer stürmischen Nacht in ihrer Hauskapelle einquartiert haben.
Wie mir der kosovarische Wirt zum Abschied Brot, eine Gurke und hausgemachten Käse schenkt.
Glück, so denke ich bei der nächsten Brotzeit, kann ein Schafskäse sein.
Wie auch immer diese Krise unserer globalisierten Zivilisation weitergehen wird: Ich wünsche uns, dass wir inmitten der Unwägbarkeiten und erzwungenen Routineunterbrechungen die Chancen sehen können. Dass wir erkennen, wie wenig es doch wirklich braucht, um glücklich zu sein.